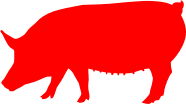Im Interview mit dem Soziologen Marcel Sebastian sprechen wir über Fleischwirtschaft, Corona, prekäre Arbeitsbedingungen und die Stigmatisierung des Tötens.

Marcel Sebastian forscht zum Mensch-Tier-Verhältnis, ist Doktorand an der Universität Hamburg und Mitglied der Hamburger „Group for Society and Animal Studies“
Für ihre Doktorarbeit haben Sie Interviews mit Schlachthof-Mitarbeitern geführt und ausgewertet und sich natürlich auch intensiv mit der Schlachtindustrie auseinandergesetzt.
Hat Sie der Corona-Ausbruch bei Westfleisch im Kreis Coesfeld, bei den anderen Schlachthöfen in Deutschland oder weltweit, wir können wohl von einem weltweiten Phänomen sprechen, überrascht?
Nein. Die Kritik an den Lebens- und Arbeitsbedingungen der osteuropäischen Arbeiterinnen und Arbeiter ist ja seit Jahren bekannt. Insbesondere die Unterkünfte werden von Gewerkschaften, Kirchen und zivilgesellschaftlichen Initiativen thematisiert und auch in den Medien wurde darüber immer wieder berichtet. Es hat sich nur kaum etwas getan. Ebenso ist bekannt, dass quasi die gesamte Branche so funktioniert.
Anscheinend gleichen sich die Produktionsbedingungen in den Anlagen im Wesentlichen. Was ist ursächlich für diese Entwicklung?
Die Fleischwirtschaft ist ein komplexes Netzwerk von Akteuren, die kooperieren oder konkurrieren und die gemeinsam den Zustand erschaffen, der aktuell herrscht. Das fängt bei den Einzelhändlern an, die mit Angeboten für günstiges Fleisch um die Gunst der Konsumierenden kämpfen. Die Schlachtunternehmen versuchen also, möglichst günstig Fleisch auf den Markt zu bringen, um Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurenz zu haben. Der Preisdruck wird zum einen an die Tierzuchtbetriebe weitergereicht. Industrielle Tierproduktion ist das Resultat einer auf maximale Profitabilität ausgerichteten Fleischproduktion. Zum anderen sparen die Schlachtkonzerne aber auch bei den Personalkosten. Hier kommen die Subunternehmen ins Spiel, die als Dienstleister der Fleischbranche Personal vermitteln – für den Mindestlohn arbeitende Werkvertragsnehmende aus osteuropäischen Ländern wie Rumänien und Bulgarien. Die Subunternehmen wollen ebenfalls ihren Gewinn erhöhen. Ihnen wird zu Beispiel vorgeworfen, sie würden überteuerte Mieten für die Unterkünfte verlangen und direkt vom Lohn abziehen. Die Politik wiederum ermöglicht dieses System – etwa durch die Gesetzgebung zu Werkverträgen. Die Situation ist also systemisch bedingt und weitgehend flächendeckend. Es handelt sich nicht um einzelne ’schwarze Schafe‘.
Im Rahmen Ihrer Dissertation haben sie sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie Schlachter mit der moralischen Stigmatisierung ihrer Arbeit umgehen. Was genau haben Sie da untersucht?
In meiner Doktorarbeit analysiere ich den kulturellen Wandel im Verhältnis der Gesellschaft zu Tieren. Ich untersuche zum Beispiel, wie sich dieser Wandel auf die institutionelle Rahmung des Mensch-Tier-Verhältnisses auswirkt, also beispielsweise auf den Wandel der Tierschutzgesetze. Und ich untersuche, wie Schlachthofarbeiter mit den spezifischen Herausforderungen ihrer Arbeit umgehen. Dabei habe ich auch den Umgangvon Schlachthofarbeit mit moralischer Stigmatisierung in den Blick genommen. Ich habe meine Interviews mit festangestellten, deutschen Schlachtern geführt, die eine Ausbildung zum Fleischer haben. Dadurch unterscheiden sie sich stark von den osteuropäischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die aktuell diskutiert werden.
Ihre Dissertation steht kurz vor dem Abschluss, welche Erkenntnisse konnten sie gewinnen?
Im Hinblick auf den Umgang mit Stigmatisierung konnte ich feststellen, dass die von mir interviewten Schlachthofarbeiter moralische Stigmatisierung erfahren. Einer sagte sehr prägnant „Die Leute denken, man sei ein Killer“. Es zeigte sich aber auch, dass die Interviewten aktiv mit dem Stigma umgehen und versuchen, der Stigmatisierung entgegenzuwirken. Dies tun sie, indem sie Deutungspraxen entwickeln und vertreten, die das Stigma delegitimieren sollen. Hier geht es vor allem um die Zurückweisung neuerer kultureller Vorstellungen, die die Legitimität menschlicher Verfügungsmacht über ‚Schlachttiere‘ oder bestimmter Formen des Umgangs mit Tieren in Frage stellen. Darüber hinaus haben meine Interviewpartner diejenigen Akteure, die sie als Quellen der Stigmatisierung ausgemacht haben, die Autorität abgesprochen, über das Schlachten urteilen zu können. Da betraf vor allem die Medien, die Tierrechtsbewegung und Menschen, die sich fleischlos ernähren, aber auch – und das sagt etwas über die wahrgenommene Verbreitung des Stigmas aus – die Öffentlichkeit als solcher. Zentrales Argument war, dass nur die Schlachter selbst einen ‚Insider-Blick‘ auf ihre Tätigkeit haben und somit als einzige wirklich legitimiert sind, ein faires und unabhängiges, vor allem aber informiertes Urteil über das Schlachten abgeben zu können. Reaktive Umgangsweisen wie das Vermeiden von sozialen Interaktionen mit potentiell kritischen Menschen oder das Verheimlichen der eigenen Tätigkeit wurden in den Interviews deutlich weniger thematisiert.
Ist eine industrielle Tiertötung bei guten Arbeitsbedingungen und ohne Stigmatisierung der Mitarbeiter*innen möglich?
Das hängt davon ab, was wir als Gesellschaft als gute Arbeit definieren. Höhere Gehälter, die Festanstellung der jetzigen Werkvertragsnehmenden, Verbesserungen in der Unterbringung, kulturelle Integration in die lokalen Strukturen – das sind gängige Forderungen, die allerdings mit hohen Kosten verbunden sind und für die wenig intrinsische Motivation aus der Branche zu erwarten sein wird. Eine auf maximale Rentabilität ausgerichtete Produktion bringt natürlich die Gefahr mit sich, dass die Arbeitsbedingungen prekarisiert werden. Politische Regelungen könnten das ändern, denn es sind ja auch die von der Politik der Großen Koalition geschaffenen, gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die das jetzige System ermöglichen. Die Stigmatisierung ist wiederum eine kulturelle Frage. Sie sagt etwas darüber aus, was in der Gesellschaft als anrüchtig oder jenseits der Normen betrachtet wird. Wenn Schlachter zunehmend moralisch stigmatisiert werden, heißt das auch, dass die Positionen zu Tierrechten, Tierwohl oder Tierethik in der Gesellschaft mehr Zuspruch erhalten. Inwiefern sich eine Schlachtpraxis etablieren lässt, die von der Mehrheit problemlos akzeptiert wird, oder ob sich hier ein grundlegender Konflikt entwickelt, der die Beziehung der Gesellschaft zu ‚Nutztieren‘ grundsätzlich in Frage stellt, wird nur die gesellschaftliche Diskussion zu diesem Thema zeigen können.